23. Februar 2011
Sprachpolitik weicht heiklen Fragen aus
Wer in die Deutschschweiz einwandert, soll Deutsch lernen – bloss welches: Dialekt oder Hochdeutsch? Zur Frage Dialekt oder Standardsprache schweigt die Sprachpolitik nicht nur in der Schweiz, sondern auch andernorts in Europa. Dies ist eine der zentralen Erkenntnisse von LINEE, einem von der Universität Bern geleiteten europäischen Forschungsprojekt.

Dialekte gelten als wichtig für die soziale und wirtschaftliche Integration von Einwanderern. Trotzdem beschäftigt sich die Sprachpolitik selten ausdrücklich mit dem Zusammenspiel von Dialekt, Standardsprache und den Sprachen von Migrantinnen und Migranten.
Dies geht aus dem internationalen Forschungsprojekt LINEE (Languages in a Network of European Excellence) unter der Leitung von Iwar Werlen vom Institut für Sprachwissenschaft der Universität Bern hervor.
Und in Gebieten mit Sprachminderheiten – zum Beispiel Rätoromanisch im Kanton Graubünden oder Katalanisch in Barcelona – wird auch selten darüber gesprochen, welche Sprache die Einwandernden aus welchen Gründen lernen sollen: die Minderheitssprache, eine der grösseren Landessprachen oder beide?
Iwar Werlen sagt dazu: «Wichtig ist einerseits, die Umgebungssprachen verstehen zu lernen. Andererseits sollten Einwanderinnen und Einwanderer ihre sprachlichen Möglichkeiten aber auch ausnützen, um sich auszudrücken – unabhängig von Korrektheit und Normbezug.»
Untersuchungen in England, Spanien und der Schweiz haben gezeigt, dass Sprache als zentrales Mittel zur Integration gesehen wird – jedenfalls aus der Sicht der jeweiligen Regierung. Viele Migrantinnen und Migranten denken allerdings anders. Denn manche leben in Gebieten, in denen sie im Alltag keine Landessprache benötigen; andere haben nicht vor, lange zu bleiben. Dritte wiederum brauchen auch an ihrem Arbeitsplatz keine der Landessprachen.
Die Wichtigkeit von Sprachkenntnissen für die soziale und wirtschaftliche Integration ändert sich offenbar mit den Gründen für Migration, der Dauer des Aufenthalts, dem Beruf, dem gesellschaftlichen Status und dem Ort der Einwanderung.
Mehrsprachigkeit nicht als Ressource genutzt
Wie die LINEE-Resultate weiter zeigen, werden umgekehrt die Sprachkenntnisse von Migrantinnen und Migranten in den Einwanderungsländern selten wertgeschätzt. Mehrsprachigkeit im Allgemeinen wird in den Schulzimmern nicht als Ressource genutzt. Viele Lehrpersonen – befragt in Italien, Österreich und England – sind sogar der Meinung, dass das Erlernen und Benutzen mehrerer Sprachen gleichzeitig ein Lernhindernis sei. Dabei stellen gemäss Iwar Werlen die Sprachkenntnisse von Migrantenkindern eine Chance für das Lernen von Sprachen und interkultureller Kompetenz dar.
Die Rolle des Englischen in Europa
Englisch als Universalsprache – ein wichtiges Thema auch beim LINEE-Projekt: Nach den Aussagen einiger der Befragten wird die englische Sprache allzu sehr genutzt. Für sie ist Englisch eine Bedrohung für die Mehrsprachigkeit.
Studierende im Erasmus-Programm dagegen sehen die englische Sprache als neutrales Kommunikationsmittel, mit dem sie sich Zugang zu Gebieten und Menschen verschaffen, die ihnen sonst verschlossen blieben. Für sie reicht es nicht aus, bloss Englisch zu sprechen; vielmehr ist Englisch der Anfang oder ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Mehrsprachigkeit.
Das Projekt LINEE
LINEE war ein wissenschaftliches Netzwerk aus neun europäischen Universitäten, die gemeinsam zum Thema Mehrsprachigkeit in Europa geforscht haben. LINEE wurde als «Network of Excellence» durch das 6. Forschungsrahmenprogramm der EU teilfinanziert.
Die Universität Bern koordinierte das Projekt und arbeitete an der Forschung mit. LINEE hat auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene zu vier Themen geforscht: Sprache, Identität und Kultur; Sprachpolitik und -planung; Mehrsprachigkeit und Bildung; Mehrsprachigkeit und Wirtschaft.
ub
Kontakt:
http://linee.info/linee/news.html?PHPSESSID=a00b1c9a1e92f31fc57ce7f9f0923657
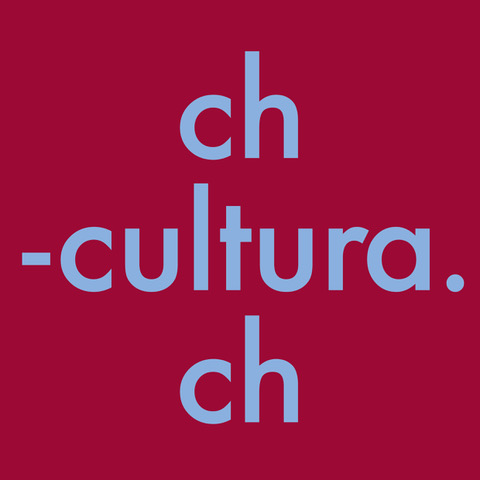






Kommentare von Daniel Leutenegger